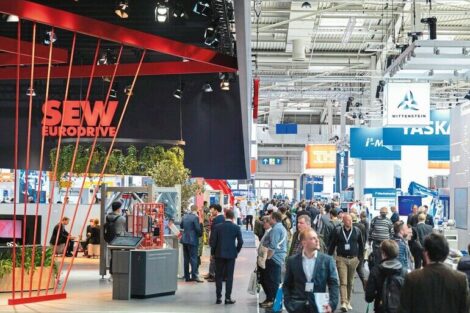Industrie 4.0 erweitert die Arbeit im Engineering um die Ebene der vernetzten Daten. Um mit diesem Plus an Komplexität fertig zu werden, müssen sich Engineering-Teams eine Arbeitsweise aneignen, die Transparenz in den Vordergrund stellt.
Wie gut ist das Engineering in deutschen Unternehmen aufgestellt, um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen? Die Ergebnisse der VDMA-Studie „Industrie 4.0 im Anlagenbau 4.0“ vom letzten Jahr ergeben ein stark divergierendes Bild. Während fast 40 % der Befragten das eigene Unternehmen als „für Industrie 4.0 gut aufgestellt“ halten, liegt dieser Anteil beim Urteil über die gesamte Branche bei nur 10 %.
Als Voraussetzung für die Erfüllung dieser Anforderungen sieht die Studie eine Weiterentwicklung der traditionellen Arbeitsweise hin zu einem „multidisziplinären Systems Engineering“, das sich am digitalen Lebenszyklus einer Anlage orientiert. Das beinhaltet eine integrative Entwicklung von Produkt, Prozess und Produktionssystem und setzt seinen Schwerpunkt auf die Verfügbarkeit von Prozessdaten quer über alle Bereiche, inklusive Rückkoppelungsschleifen aus dem Betrieb. Hierfür müssten auch alle Planungsaktivitäten über alle involvierten Bereiche hinweg transparent sein und parallel laufen, da Änderungen in der Datenbasis in allen Systemen berücksichtigt werden müssen.
Die allgemeine Verfügbarkeit von Daten über Entwicklung, Produktion und Betrieb hinweg macht allerdings eine ebenso transparentere Arbeitsweise quer durch alle Abteilungen nötig. „Transparenz bedeutet ,Wer macht was mit wem und bis wann’“ sagt Holger Lörz, Geschäftsführer des Software-Anbieters Actano. Lörz berät Unternehmen in Sachen Projektmanagement und glaubt, dass diese Art von Transparenz heute noch nicht so weit verbreitet ist, wie es wünschenswert wäre. In den meisten Unternehmen müsse hierfür erst ein Kulturwandel stattfinden.
Transparenz ist eine Sache der Haltung
Lörz wendet bei seiner Arbeit meist die Methode des Critical Chain Project Management (CCPM) an. Diese hat Ähnlichkeiten mit agilen Methoden, wie sie aus der Software-Entwicklung bekannt sind, und stellt eben-diese Transparenz in den Mittelpunkt, auch bei Kleinigkeiten. Bei der Projektplanung beispielsweise werden Teams dazu aufgefordert, bei ihrer Aufwandsabschätzung zu differenzieren, wieviel der veranschlagten Zeit sich auf die tatsächliche Arbeitszeit bezieht und wieviel als Puffer vorgesehen ist.
In herkömmlichen Verfahren wird dieser Unterschied ungern gemacht, weil die Mitarbeiter wissen, dass die Zeitangabe vom Projektmanager in eine Vereinbarung umgewandelt wird, an die sie sich halten müssen und daran gemessen werden. Aus Angst, beim nächsten Mal weniger Zeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, wird der Puffer in der Regel ausgereizt. Die Mitarbeiter passen die Fertigstellung einer Aufgabe an die abgegebene Zeitschätzung an und liefern erst zum Ende dieser Zeit.
Anders im CCPM-Verfahren: Ist eine Arbeit auch ohne Beanspruchung des Puffers fertig, wird das gemeldet, damit das Projekt in die nächste Bearbeitungsstufe gehen kann. Gibt es Verzögerungen und wird der Puffer genutzt oder überstrapaziert, hat das keine Auswirkungen für die Mitarbeiter. Man versucht, aus den Problemen zu lernen und sie nächstes Mal zu vermeiden.
Diese Haltung sei vor allem für viele Führungskräfte ein Kulturschock, erklärt Lörz. „Wenn die Führungskraft eine Schätzung nicht mehr in einen Vertrag umwandeln kann, verliert sie eine Möglichkeit der Beurteilung und sie muss sie mit dem Vertrauen ersetzen, dass der Mitarbeiter sich Mühe gibt, seinen Job so gut wie möglich zu machen.“ Das werde allerdings von Führungskräften oft als Kontrollverlust empfunden, weil sie bei Problemen keinen Schuldigen mehr nennen können.
„Bei der alten Arbeitsweise geht es um Kontrolle, bei der neuen um die Reihenfolge der Abarbeitung und um die Frage, wie man Ressourcen optimal einsetzen kann“, sagt Lörz. Und das sei genau die Art von Zusammenarbeit, die man für Industrie 4.0-Projekte brauche. „Bei Industrie 4.0 geht es vor allem darum, Komplexität managen zu können und Schnittstellen zu schaffen, um eine andere Art der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Komplexität kann man aber nicht über Verträge beherrschen. Hier hat man es immer mehr mit Zeitfenstern, Übergaben, mit virtueller Zusammenarbeit und dezentralen Strukturen zu tun. Das heißt oft, dass das Software-Modul, das ich brauche, womöglich schon jemand entwickelt hat, ich muss nur wissen, wer das war und wo es ist. Das geht nur über Transparenz.“
Collaboration-Plattformen allein reichen nicht aus
Die vernetzte Zusammenarbeit zwischen unterschied-lichen Teams setzt außerdem die Bereitschaft zum freien Informationsaustausch voraus – was wiederum bedeutet, Fachwissen zu teilen. Auch dieser Prozess ist nicht ohne Hürden, weil die Mitarbeiter sich erst vergewissern müssen, dass das Preisgeben von Informationen keinen Kontrollverlust bedeutet oder dass sie sich damit überflüssig machen.
„Aus der Einstellung heraus, dass Wissen Macht ist, schafft man das mit Sicherheit nicht“, meint Robert Gögele, Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Avanade, einer Tochter von Accenture und Microsoft. Plattformen für die digitale Zusammenarbeit wie etwa ein Projektmanagement-System oder Office 365 helfen hier als Basis, Informationen für alle relevanten Leute verfügbar zu machen. Doch deren Installation allein mache keinen Unterschied.
„Wenn man ein solches System nur als technische Maßnahme versteht, bekommt man wenig Ergebnisse“, sagt Gögele. „Die Leute sind sowieso schon ausgelastet und wenn man ihnen noch zwei zusätzliche Arbeitsplattformen an die Hand gibt, fragen sie sich, warum sie jetzt das auch noch tun sollen. Damit ändert sich nichts an der Arbeitsweise oder an der Arbeitskultur, weil es weder ein richtiges Training für die neuen Arbeitsmethoden noch ein Anreizsystem dazu gibt.“
Um lange etablierte Arbeitsweisen zu ändern, brauche es einerseits einen Kulturwandel, andererseits die passenden Anreize. „Wir haben bis jetzt keine einzige Einführung von Office 365 begleitet, ohne gleichzeitig ein Change-Programm durchzuführen“, sagt Gögele. Würde man es auslassen, so würde beispielsweise niemand die darin enthaltenen Kommunikationsmöglichkeiten von Skype Business oder die Team-Funktionen nutzen.
Auch die Anreize, die neuen Plattformen zu nutzen, müssten laut Gögele fassbar sein. „Man muss hierfür ein Incentive-System hinterlegen, damit die Leute auch einen persönlichen Vorteil für sich sehen.“ Motiviert würden die Mitarbeiter durch ein Belohnungssystem, das ihnen Anerkennung schenkt, wenn sie anderen helfen – und letzteres drückt sich auch in Euro und Cent aus. „Auf diese Weise wird es mit der Zeit selbstverständlich, dass Mitarbeiter aufmerksam sind und sehen, wenn jemand ihre Hilfe braucht, und irgendwann gehört es zur Firmenkultur“, meint der Avanade-Chef.
Jannis Moutafis, Journalist in München
Unsere Whitepaper-Empfehlung
Benutzeridentifizierung und Zugangskontrolle verbessern Sicherheit und Transparenz im Flottenmanagement
Teilen: