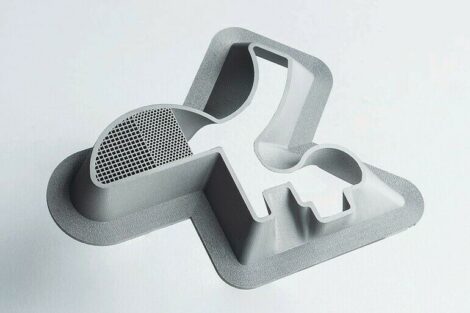Was verstehen Sie unter dem Internet of Things, Herr Völker?
Es beschreibt die Vernetzung von physischen Produkten der wirklichen Welt in einer virtuellen, Internet-ähnlichen Struktur. Was das Internet der Dinge bewirkt, dokumentiert das Beispiel eines Sportschuhherstellers, der in der Sohle eines Joggingmodells Sensoren integrierte, um die Schrittabfolge zu registrieren. Die Daten konnten über das Netz ausgelesen werden. Das Ergebnis: 90 Prozent der Käufer dieser Schuhe joggten nie, sondern sie gingen mit ihnen maximal in Schrittgeschwindigkeit. So fand der Hersteller heraus, dass dieses Produkt von einer völlig anderen Zielgruppe gekauft wurde, als er annahm. Seine Marketingstrategie war demnach völlig falsch.
Ist das Internet der Dinge gleichzusetzen mit dem, was Experten unter Industrie 4.0 verstehen?
Beide Begriffe werden häufig im gleichen Zusammenhang verwendet. Doch das ist Unsinn. Bei Industrie 4.0 geht es darum, die Wertschöpfungskette eines Unternehmens weitgehend automatisiert zu steuern. Damit das klappt, braucht man das Internet of Things, das IoT, als Grundlage. Ich muss also Maschinen oder Werkstücke erst einmal vernetzen, um eine leistungsfähigere Wertschöpfungskette zu erhalten.
Das Internet der Dinge bewirkt, dass Produkte anders vermarktet werden müssen als bisher. Das hat sich in vielen deutschen Unternehmen noch nicht herumgesprochen.
Unser Maschinenbau entwickelt Produkte nach dem Wasserfallmodell: Jemand hat eine Produktvision, darauf folgen erste Kundengespräche, und daraus resultieren die Design- und die Prototypenphase. Also immer topdown. Bis das Produkt marktreif ist, dauert es meist Jahre – mit dem Nachteil, dass man Erfahrung mit der Marktdurchdringung erst am Schluss des Zyklus macht. Mit dem Internet der Dinge kann man das ändern – über den Minimum-Viable-Product-Ansatz, der nach dem minimalst marktfähigen Produkt sucht.
Das müssen Sie erklären.
Solche Produkte können nur ganz wenig, sind aber vernetzt. So sammelt der Hersteller bei schnell herausgebrachten, im traditionellen Sinn eher unfertigen Produkten sofort Markterfahrungen. Und über die Vernetzung liefert der Hersteller per Software-Update neue und bessere Funktionen nach.
Funktioniert das ähnlich wie beim iPhone?
Genau. Als das iPhone auf den Markt kam, war es mit weitreichender Sensorik bestückt, für die es damals kaum Anwendungen gab. Nach und nach änderte sich das mit Updates oder Apps. Die Installation neuer Software orientiert sich am Hardwarefundus des Geräts, den unterschiedliche Anbieter unterschiedlich interpretieren. Bei modernen Autos zeichnet sich Ähnliches ab: Sie haben mehr Hardware an Bord, als die Nutzer bezahlen. Hätten sie dann gerne – etwa für eine längere Nachtfahrt – ein umfassendes Assistenzpaket, können sie nur für diese Fahrt upgraden. Auch die Motorenleistung lässt sich auf diese Weise individuell anpassen.
Das geht aber bloß, wenn der Motor eine eingebaute Leistungsreserve – sprich: mehr Kilowatt – mit sich führt. Das verteuert den Preis.
Das müssen Sie anders betrachten. Eine Riesenherausforderung heute ist die Variantenvielfalt, die beim Hersteller für Kosten an verschiedensten Stellen sorgt – in der Lagerhaltung, bei der Produktion, bei der Instandhaltung. Wer nur wenige Motortypen anbietet, die über Software herauf- und heruntergeregelt werden können, produziert billiger und kann den wertigeren Motor ohne Preisanpassung einbauen.
Wie verbreitet ist diese neue Denkrichtung in der mittelständischen Produktion?
Selbst wenn die Erkenntnis da ist – und auch der Wille, etwas zu verändern –, ist der Fisch noch nicht geputzt, salopp gesagt. Man braucht das Know-how, man braucht Finanzmittel, die sich nicht sofort amortisieren. Es geht um neue Technologie, um neue Märkte, also um etwas Hochkomplexes. Ich denke, dass einige Marktteilnehmer da nicht mehr mitkommen und ausscheiden.
Wie können sich mittelständische Unternehmen das nötige Know-how beschaffen?
Zu Beginn ist es immer ratsam, sich Berater und Partner zu holen. Ein guter Weg ist: Erste Produkte gemeinsam mit erfahrenen Partnern entwickeln, eigene Mitarbeiter dadurch schulen und dann erst langsam die erforderlichen Experten fest ins Unternehmen holen.
Wie wählt man die Partner aus?
Das ist gar nicht so einfach, weil inzwischen viele Firmen behaupten, gute Berater zu sein – Chiphersteller, Telekommunikationsunternehmen, klassische Strategieberater. Ich glaube, dass es am besten ist, wenn man sich ein Ingenieurbüro – wie man früher gesagt hätte – ins Haus holt: einen Partner also, der als Generalunternehmer agiert, verschiedene Zulieferer koordiniert und auch strategisch unterstützt. Nachgefragt ist das Konzept der agilen Entwicklung – weg vom klassischen Lasten- und Pflichtenheft. Alles ist im Fluss, spezifiziert wird erst während der Entwicklung. Das ist etwas, das US-Amerikaner gut können.
Wie erleben Sie die Auseinandersetzung im deutschen Maschinenbau zwischen eher traditionellen Entwicklern und denen, die über das Internet of Things an die Produkte herangehen?
Wer IoT-orientiert ist, muss sich häufig gegen etablierte Prozesse stellen – man bricht gewissermaßen mit den Gesetzen eines Unternehmens. Wer IoT erfolgreich einführen möchte, muss sich von konventionellen Entwicklungsprozessen lösen und neue etablieren. Unternehmen, die diesen Weg einschlagen, gründen häufig aus dem Mutterhaus eine neue Gesellschaft aus, weil man dadurch meist schneller mit bestehenden Strukturen brechen kann. Das Problem dabei ist, Industrie 4.0 auf die bestehenden Geschäftsbereiche zurück zu übertragen. Spätestens dann brechen im Mutterhaus die Kämpfe zwischen den Abteilungen aus.
Sie erwähnten, dass sich durch die neue Produktionsphilosophie auch die Vermarktungsstrategie ändern muss. An was denken Sie konkret?
Der klassische Maschinenbauer kalkuliert etwa so: Wenn ich in eine bestehende Maschine zusätzlich Hard- und Software einbaue, erhöht das meine Herstellkosten. Wenn das beispielsweise 10 000 Euro ausmacht, kommen Preisaufschläge drauf, und die Maschine geht für 20 000 Euro mehr in den Markt. Der moderne Marktansatz sieht folgendermaßen aus: Die Maschine wird durch die Hard- und Software-Integration zwar teurer, doch das schlägt sich nicht im Abgabepreis nieder. Sondern man überlegt, durch welche Varianten sich die Mehrkosten finanzieren lassen. Mein Lieblingsbeispiel ist Facebook. Dort ist die Nutzung für den User kostenlos. Die Firma finanziert sich über Dritte – über Werbung. Zugespitzt behaupte ich: Wenn ein deutscher Maschinenbauer Facebook erfunden hätte, würde der Zugang etwas kosten, und wahrscheinlich hätte man die Software noch über eine CD-ROM verschickt. Amerikaner sind einfach besser drauf, wenn es um Finanzierungsmodelle geht.
Im einen Fall handelt es sich um einen Endkundenmarkt, im anderen aber um einen B2B-Markt.
Zugegeben. Aber auch im Business-to-Business-Markt gibt es bereits moderne Strategien. Rolls-Royce baut Flugzeugturbinen. Doch die werden längst nicht mehr im klassischen Sinn verkauft. Das Unternehmen stellt die Turbinen zur Verfügung, und die Fluggesellschaften bezahlen nur noch die Dienstleistung, dass die Turbinen die Flugzeuge sicher von A nach B bringen. Damit das gut funktioniert, überwacht Rolls-Royce über das Internet of Things in Echtzeit alle wesentlichen Turbinendaten. Sobald sich eine Unregelmäßigkeit zeigt, rückt der Reparaturtrupp ran. Rolls-Royce liefert nicht mehr nur Turbinen, sondern auch den Reparaturservice, der integraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist. Andere Bewerber gibt es nicht, weil durch die Datenübermittlung per Internet Rolls-Royce stets näher am Problem dran ist als sonstige Service-Unternehmen. Ein Patentrezept für erfolgreiche IoT-Geschäftsmodelle gibt es allerdings nicht.
Was müssen Unternehmen ändern?
Die Universität St. Gallen hat das in einer Studie akribisch weltweit untersucht. Das wichtigste Ergebnis: Die Ubers, Googles, Amazons und Ali Babas dieser Welt sind nicht durch Produkt- oder Prozessinnovation erfolgreich geworden, sondern durch Innovation bei den Geschäftsmodellen: Sie vermarkten clever! Und: Auf die Beine gestellt haben sie ihre Geschäftsmodelle nicht durch einen völlig neuen Ansatz, sondern durch eine Rekombination existierender Muster. Laut der Universität St. Gallen gibt es grundsätzlich nur 55 Muster möglicher Geschäftsmodelle. Wer diese im Hinblick auf seine Produktion prüft, hat eine gute Chance, strukturierter vorzugehen und dadurch erfolgreicher zu sein.
Können wir das Ganze einmal pragmatisch durchgehen – etwa am Beispiel eines Gabelstaplerherstellers?
Als Hersteller von Gabelstaplern weiß ich, dass damit häufig Arbeitsunfälle passieren – etwa durch Zusammenstöße. Ein Kundenbedürfnis ist also Sicherheit. Nehmen wir einmal an, dass die meisten Unfälle an Kreuzungspunkten in der Lagerhalle zustande kommen. Wenn man in Echtzeit über Sensorik erkennen würde, wo sich die Gabelstapler gerade bewegen, könnte man ihre Geschwindigkeit bei einer gefahrenkritischen Einfahrt in eine Kreuzung automatisch reduzieren – egal was der Fahrer macht. Die integrierte Sicherheitssystematik wäre dann ein Kundennutzen. Ein intelligentes Geschäftsmodell wäre, dass der Kunde die neue Sicherheitseinrichtung für eine Reihe automatischer Bremsvorgänge ohne Aufpreis erhält. Er kann über einen bestimmten Zeitraum dann selbst beobachten, wie sich die Unfallrate entwickelt. Wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass sie nachweislich kleiner geworden ist, wird er für die automatisierten Bremsvorgänge künftig gewiss gerne einen Servicebetrag bezahlen, weil seine Lagerhaltung dadurch unfallfreier ist.
Und wie profitiert der Hersteller selbst?
Und wenn die Gabelstapler einmal vernetzt sind, bietet sich eine Reihe weiterer Optimierungen an. Durch die vernetzte Sensorik weiß der Hersteller nun exakt, wie lange und in welchen Frequenzen die Gabelstapler eingesetzt werden. So kann er die Batterie optimieren, vielleicht sogar leichter wählen. Damit nicht genug: Durch die Vernetzung bekommt der Gabelstaplerhersteller Daten über die Lagerhaltung. Die kann er anonymisiert auswerten und Unternehmen anbieten, die bisher noch nicht mit ihm zusammengearbeitet haben – etwa Lageroptimierern. Dadurch hätte er ganz nebenbei ein neues Kundenpotenzial erschlossen. Mit herkömmlich agierenden Vertriebsmitarbeitern ist das allerdings nicht zu machen. Dazu braucht es Leute, die den Kunden herausfordern. In den USA sagt man dazu „challenger sales approach“.
Vita Friedrich Völker
Völker, Jahrgang 1985, promovierte an der Universität Stuttgart am Lehrstuhl für Finanzwissenschaften über Strategien in Familienunternehmen. Danach begann er bei einem Maschinenbau-Unternehmen im Raum Stuttgart als Assistent des Vorstands und registrierte, dass das Internet der Dinge ein Zukunftsthema wird. Seit 2015 ist er verantwortlich für digitale Produkte. Friedrich Völker hält an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) im Studiengang „Wirtschaft – Dienstleistungsmanagement – Medien und Kommunikation“ eine Vorlesung über das „Internet of Things“.