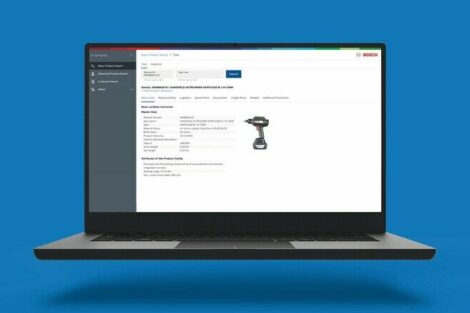Die additive Fertigung eröffnet Unternehmen völlig neue Möglichkeiten. Doch wer diese nutzen möchte, sollte auch die rechtlichen Herausforderungen, die damit einher gehen können, nicht unterschätzen.
Diese zeigen sich zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit einem Dienstleister – was beim Thema 3D-Druck häufig der Fall ist. Denn viele Unternehmen investieren noch nicht selbst in Anlagen. Sie lagern die additive Fertigung stattdessen an Dienstleister aus, die über die Technologie und das entsprechende Prozess-Know-how verfügen.
Häufig schlägt der Dienstleister dabei – zumindest in Teilen – eine Neukonstruktion des Produkts vor. Schließlich lassen sich erst auf diese Weise einige Vorteile des 3D-Drucks nutzen – wie zum Beispiel eine Reduzierung des Gewichts.
Urheber ist der Designer
Ein entscheidender Punkt ist dabei laut Rechtsanwalt Leupold, von wem die Änderungen vorgenommen werden. Ist dies der Dienstleister, „dann liegen die Rechte an diesem so genannten Besserteil beim ihm, weil er die Konstruktion neu aufgesetzt hat“, so Leupold.
Heißt konkret: Das Recht auf das Patent hat der Dienstleister, weil er in in diesem Fall als Erfinder gilt. Urheber im Sinne des Urheberrechts ist der Schöpfer des Werkes. „Grundsätzlich liegen die Rechte immer bei demjenigen, der etwas Neues geschaffen oder eine individuelle geistige Leistung erbracht hat“, erklärt Leupold.
Dabei ist darauf zu achten, dass das Urheberrecht stets einer natürlichen Person und nicht einem Unternehmen zugeordnet wird. Hat der Dienstleister einen freien Mitarbeiter engagiert, muss dieser seine Rechte somit zunächst abtreten, bevor diese dann an den Auftraggeber weitergegeben werden können.
Diese Umstände seien vielen Firmen nicht bewusst, wenn sie mit Dienstleistern zusammenarbeiten, berichtet Leupold. Das ist gefährlich. Denn als Auftraggeber ist es Sache des Unternehmens, sich darum zu kümmern, dass ihm die entsprechenden Rechte bei einer Neukonstruktion übertragen werden. Auch mit seinen Arbeitnehmern sollte der Dienstleister klare Vereinbarungen über die Nutzung der Arbeitsergebnisse schließen.
Klare Vorgaben – aber nicht zu genau
Daneben sind auch spezifische Qualitätssicherungsvereinbarungen zwischen Auftraggeber und Dienstleister abzuschließen. In diesen werden konkrete Vorgaben formuliert, welche Merkmale das zu fertigende Produkt besitzen soll.
Auch das kann eine Herausforderung darstellen: Es gehe darum, „die richtige Balance zwischen ausreichend detaillierten Angaben für die Auswahl geeigneter Materialien und Verfahren sowie deren Anwendung einerseits und einer Fernsteuerung der Auftragsfertigung andererseits zu finden, die zu einer weitgehenden Enthaftung des Auftragnehmers führen kann“, sagt Leupold.
Will heißen: Sind die Vorgaben zu genau, kann der Dienstleister nicht mehr in Regress genommen werden, wenn das additiv gefertigte Produkt Fehler aufweist. Dann kann dieser darauf verweisen, sich exakt an die Qualitätssicherungsvereinbarungen gehalten zu haben.
Leupold empfiehlt daher, die Vorgaben ergebnisorientiert aufzusetzen. „Man formuliert, welche Eigenschaften das fertige Produkt haben soll“, so der Anwalt. „Dann ist es Sache des Auftragnehmers, wie er diese Eigenschaften erreicht.“
Häufig sind in die additive Fertigung eines Produkts jedoch mehr als zwei Parteien involviert. So haben zum Beispiel große Technikanbieter wie etwa Siemens oder Dassault damit begonnen, Netzwerke für den 3D-Druck aufzubauen, an denen verschiedene Player beteiligt sind. Dazu zählen Materiallieferanten, Auftragsfertiger oder Unternehmen, die sich um die Nachbearbeitung der Produkte kümmern.
Nach Meinung von Leupold ist dies erst der Anfang. Schließlich erlaube es die additive Fertigung wie keine andere Technik vor ihr, kundennah zu produzieren. Dies erfordere aber eine vernetzte Produktion.
Auch dieser Umstand hat rechtliche Konsequenzen. An allen Schnittstellen zwischen den einzelnen Playern müssen juristische Aspekte beachtet werden. Dabei geht es laut Leupold unter anderem um Fragen hinsichtlich Gewährleistungsrecht, Produkthaftungsrecht und Sicherheit der Produktion.
„Konstruktions- und Produktionsdaten sind dann nur noch sicher, wenn in der gesamten Liefer- und Produktionskette ein vergleichbares Schutzniveau herrscht“, sagt Leupold. Um dies zu erreichen, müssten mit allen externen Datenempfängern Industrial Security Agreements (ISA) geschlossen werden, in denen die technischen und organisatorischen Maßnahmen festgelegt werden, die zum Schutz der Daten vor unbefugten Zugriffen Dritter oder auch eigener Mitarbeiter ergriffen werden müssen.
Unternehmen fehlt der Überblick über ihre Daten
Viele Unternehmen können aber seiner Meinung nach die notwendigen Vereinbarungen nicht abschließen, weil sie gar keinen Überblick über die Datenflüsse in ihrer Konstruktion und Fertigung haben.
Vor dem Abschluss geeigneter ISAs sollte zudem bedacht werden, dass nicht alle Informationen den gleichen Schutz erfordern. „Anstelle eines One-Size-fits-all-Konzepts ist deshalb die Bildung von Schutzklassen gefragt, die unterschiedlicher vertraglicher Absicherung bedürfen.“
Hinzu kommt: „Die 2018 in deutsches Recht umzusetzende Europäische Know-how-Schutzrichtlinie verlangt, dass vertrauliche Informationen durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt werden“, so Leupold. Geschehe dies nicht, verlören sie den Schutz als Geschäftsgeheimnis und könnten somit von jedermann gefahr- und sanktionslos genutzt werden. „Auch darauf sollten Unternehmen vorbereitet sein.“
Ohne Prüfungen wird es fahrlässig
Aber auch wenn ein Unternehmen Bauteile per 3D-Druck selbst herstellt, statt einen Dienstleister damit zu beauftragen, lauern juristische Stolperfallen. Das gilt etwa bei der Fertigung von Ersatzteilen. Gerade die Herstellung von Teilen, die vom Anbieter nicht mehr produziert werden oder die nur in geringen Mengen benötigt werden, ist ein geeignetes Einsatzfeld für den 3D-Druck.
Wer allerdings seine Ersatzteile selbst produzieren möchte, muss vorab eine so genannte Freedom-to-operate-Analyse durchführen. In dieser wird zunächst geklärt, ob durch die Fertigung die Schutzrechte Dritter verletzt werden.
„Dann beginnt die patentrechtliche Prüfung“, so Leupold. Diese beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob das Bauteil selbst geschützt ist oder nur das gesamte Erzeugnis, in dem das Bauteil enthalten ist. „Wer solche Prüfungen unterlässt, handelt grob fahrlässig“, warnt der Anwalt.
Außerdem ist zu beachten: Wer selbst Werkstücke produziert, für den gelten auch die gleichen Rechte und Pflichten wie für einen Hersteller.
Leupold gibt ein Beispiel: „Wenn ein Zahnarzt einen 3D-Drucker in seine Praxis stellt, um dort etwa Zahnersatz zu produzieren, dann wird er zum Hersteller. Und dieser muss auch für Produktfehler haften.“
Die Herstellereigenschaft könne sich somit von einer großen Firma auf sehr kleine Betriebe oder sogar Einzelpersonen verlagern. „Im Produkthaftungsrecht geht der Gesetzgeber davon aus, dass derjenige haftet, der sich dies auch leisten kann – nämlich ein Unternehmen“, erklärt Leupold. „In Zukunft werden aber zunehmend auch die Ersteller von 3D-Modellen sowie Einzelanwender haften.“
Marker helfen bei Produkthaftung
Die additive Fertigung stellt jedoch aus rechtlicher Sicht nicht nur eine Herausforderung dar. Sie bietet auch die Möglichkeit, sich wirksam gegen Produktpiraterie zu wappnen. Dank dem 3D-Druck ist es möglich, Produktmarker in das gefertigte Werkstück zu integrieren, die von außen nicht zu erkennen sind.
So lässt sich der Hersteller eindeutig zuordnen – was auch aus Sicht des Produkthaftungsrechts hilfreich sein kann. Dank der Rückverfolgbarkeit kann ein Hersteller prüfen, ob es tatsächlich sein Produkt war, das einen Fehler verursacht hat – etwa die defekte Bremsscheibe im Auto. Handelt es sich bei dem Produkt eindeutig belegbar um eine Fälschung, muss er nicht haften.
Generell sollten rechtliche Gründe Unternehmen nicht davon abhalten, sich mit der der additiven Fertigung zu beschäftigen, meint Leupold. Wenn es zum Beispiel um die vernetzte Produktion geht, stehe die juristische Diskussion zwar noch am Anfang Aber: „Wir brauchen nicht für alles neue Gesetze“, so der Anwalt. „Die Firmen müssen sich jedoch mit den rechtlichen Risiken beschäftigen und entsprechende schriftliche Vereinbarungen treffen.“ Wenn dies geschehe, „dann kann man in der additiven Fertigung fast alles machen“.