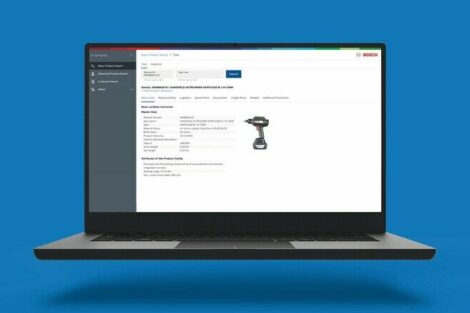Der klassische Weg zur Vermeidung von Verlustrisiken ist nur noch gegen Vorkasse zu liefern. Für viele Kunden ist die frühzeitige Umstellung auf Vorkasse aber der Todesstoß. Mangels Liquidität bleibt dann oft nur noch der Insolvenzantrag. Dies ist abzuwägen. Aber auch Vorkasse kann ihre Tücken haben. Die erhaltene Zahlung ist in einer späteren Kundeninsolvenz nur dann vor einem Rückzahlungsverlangen des Insolvenzverwalters sicher, wenn zwischen Geldeingang und eigener Lieferung maximal 30 Tage liegen (Bargeschäft). Die Attraktivität der Vorkasselieferung liegt nun darin, dass der Geldeingang auch vor Lieferung erfolgen kann. Damit hat man es selbst in der Hand, die 30-Tages-Frist einzuhalten.
Lieferstopp als letztes Mittel
Rechnet man mit einem Zahlungsausfall, liegt die beste Risikominimierung darin, die bestellte Ware gar nicht erst auszuliefern. Die „Unsicherheitseinrede“ (§ 321 BGB) erlaubt es, vertraglich geschuldete Lieferungen zurückzuhalten, bis entweder eine Zahlung erfolgt ist oder für die Zahlung eine Sicherheit gestellt wurde. Voraussetzung ist, dass ansonsten eine Gefährdung des Zahlungsanspruchs besteht. Ein solches Vorgehen ist im Einzelfall gut vorzubereiten, auch, da bei Werken in unterschiedlichen Ländern die anzuwendende Rechtsordnung bestimmt werden muss. Zudem kann der Kunde mit Schadensersatzforderungen drohen, falls ein ungerechtfertigter Lieferstopp zu einem Bandabriss oder anderen Produktionsstörungen führt.
Wer unter Eigentumsvorbehalt liefert, glaubt sich gut abgesichert. Das ist aber nicht immer der Fall. Wird der Weiterverkauf gegen Abtretung der Endkundenforderung gestattet und dem Kunden eine Einzugsermächtigung erteilt, kann der Kunde die Endkundenzahlung einziehen. Anschließend ist er zur Herausgabe der eingezogenen Forderungen verpflichtet. Kommt es jedoch zu einem Insolvenzantrag, wird der Kunde noch nicht weitergeleitete und noch weiter eingehende Gelder nicht mehr herausgeben. Der Herausgabeanspruch wird zur (meist wertlosen) Insolvenzforderung. In der eröffneten Insolvenz erlischt die Einziehungsbefugnis automatisch. Ob schon ein Insolvenzantrag ausreicht, wird in der Literatur nicht einheitlich beurteilt. Der in diesem Fall berechtigte Widerruf, ggf. auch die Offenlegung von Abtretungen gegenüber dem Endkunden, soweit er bekannt ist, sind daher in der Praxis zu empfehlen.
Strafbarkeitsvorwürfe ausschließen
Während der Corona-Krise war verstärkt zu sehen, dass Kunden ihre Lieferanten mit der Bitte um Unterstützung angeschrieben haben. Typische Anfragen betreffen die Verlängerung von Zahlungszielen/Stundungen, einen Teilverzicht, oft deklariert als „freiwilliger Sanierungsbeitrag“, bis hin zu einem Lieferantendarlehen. All dies sind rechtlich legitime und auch kommerziell oft sinnvolle Maßnahmen. Gefährlich wird es allerdings, wenn der Kunde seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten allzu sehr betont, um den Lieferanten zur Hilfe zu motivieren. Denn es gibt immer wieder Marktteilnehmer, die ihre Anfragen nicht auf der Grundlage einer ordentlichen Liquiditätsplanung stellen, sondern „von der Hand in den Mund“ leben.
Wird später festgestellt, dass der Kunde einen bereits erforderlichen Insolvenzantrag nicht rechtzeitig gestellt hatte, droht dem Mitarbeiter des Lieferanten persönlich der Vorwurf, er habe eine strafrechtlich relevante „Beihilfe zu Insolvenzverschleppung“ geleistet. Beispielsweise, weil durch Stundungen „das Leiden nur verlängert“ wurde und sich die ungedeckten Gläubigerforderungen während dieser unstrukturierten, oft aussichtslosen Sanierungsbemühungen noch vermehrt haben. Der für den Tatvorwurf erforderliche Vorsatz wurde dabei in der Rechtsprechung immer weiter aufgeweicht und droht schon, wenn Umstände bekannt sind, nach denen sich eine Insolvenzantragspflicht, insbesondere Zahlungsunfähigkeit, des Kunden aufdrängen musste.
Werden in einer solchen Situation Zahlungen geleistet, droht bei einer späteren Insolvenz bis zu vier Jahre rückwirkend eine Insolvenzanfechtung. Erhaltene Zahlungen sind dann an den Insolvenzverwalter zurückzuzahlen, im Regelfall, ohne dafür einen Gegenwert zu erhalten. Auch hier hatte die Rechtsprechung den gesetzlichen Tatbestand stark ausgeweitet. Wer die Krise seines Kunden einmal kannte, musste somit auch nach einer scheinbaren Beseitigung der Krise immer mit einem Anfechtungsrisiko leben. Mit einem Urteil aus dem Mai letzten Jahres, welches der Bundesgerichtshof als „Neuausrichtung der Insolvenzanfechtung“ bezeichnete, hat sich dies etwas relativiert. Ein Risiko bleibt dennoch. Daher sollte man sich nach einer einmal erlangten Kenntnis stets überzeugen, dass die Krise nachhaltig beseitigt wurde.
Fazit
Gerade in Zeiten wie diesen sollten Unternehmen das Verhalten ihrer Kunden sorgfältig beobachten. Abweichungen im bisherigen Bestellverhalten wie auch in der Zahlungstreue sollten übereinandergelegt werden und offenbaren oft frühzeitig erste Alarmzeichen. Es gibt in solchen Situationen bewährte Mittel, die wirtschaftlichen Ausfallrisiken zu minimieren. Die Umsetzung sollte jedoch auch unter strategischen Gesichtspunkten wie dem Erhalt der Kundenbeziehung austariert werden.