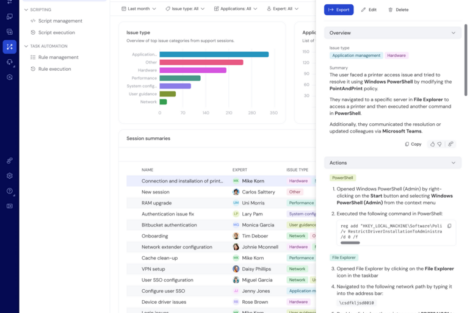Firmen im Artikel
Inhaltsverzeichnis
1. „Plug + Produce“ war schon vor 20 Jahren das große Ziel
2. Wo das neue Produkt gefertigt wird, ermittelt die Anlage selbst
3. Roboter teilen die Arbeit untereinander auf
4. KI soll und kann den Menschen nicht ersetzen
5. Durch Modularität bleibt die fertigende Anlage flexibel und veränderbar
6. Modulare Produktionslinien senken Kosten
Die Krise durch die Corona-Pandemie verstärkt noch den Ansporn, Produktionen flexibel zu gestalten, weil die Bedarfe sich in kürzester Zeit verändern. Die damit verbundenen Anforderungen bringen kleine und mittelgroße Hersteller regelmäßig an ihre Grenzen. Sie müssen eine wachsende Zahl an Produktvarianten in immer kürzeren Zeitintervallen bewältigen und benötigen dafür anpassbare Produktionslinien. Und der Trend geht zu immer noch kleineren Losgrößen. Die naheliegende Lösung besteht darin, robotergestützte Standardkomponenten nach Bedarf zu kombinieren. Einerseits lassen sie sich einfach austauschen, andererseits schnell per Knopfdruck an neue Produkte mit ihren unterschiedlichen Geometrien anpassen. Große Unternehmen setzen dabei auf die smarte Fabrik und somit auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI).

Die Entwicklung schreitet in Deutschland nur zögerlich voran, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Zwar werden überall zahlreiche Neuentwicklungen vorgestellt. Doch gehen diese regelmäßig an den KMU vorbei. Ihre Maschinenparks sind häufig veraltet, Investitionen können sie finanziell nicht stemmen. Und dem System Industrie 4.0 trauen viele nicht. Für KMU sind moderne Maschinen oft überdimensioniert. Sie kämpfen ohnehin mit ihren digitalen Netzwerken. Und dann Smart Factory?
Was den KMU entgegenkommen könnte: Auch in diesem Feld ändern sich die Sichtweisen. Modulare Produktion ist kein neues Thema. Die TU Chemnitz entwickelte schon 2002 Konzepte, die es vor allem KMU erlauben sollten, ihre Produktion schnell und ohne großen finanziellen Aufwand hoch- und wieder zurückzufahren oder sogar ganz umzustellen. „Nicht nur die Maschinen sollten in Zukunft wandelbar sein, sondern gleich die ganze Fabrik“, sagte damals Projektleiter Prof. Hartmut Enderlein. „Die Fabrik von morgen wird sich den immer kürzeren Lebenszyklen der Produkte und Prozesse flexibel anpassen müssen, um weiter produktiv zu arbeiten.“ Denkbar sei hierbei sogar, eine solche modulare Produktionsstätte komplett an einen anderen Standort zu verlagern.

„Plug + Produce“ war schon vor 20 Jahren das große Ziel
„Hier steht unsere erste Maschine, die vollkommen aus einzelnen Modulen besteht“, erklärte damals stolz Dr. Thilo Richter von der Karl Utz Sondermaschinen GmbH (USK), die am „Plug+produce“-Projekt der TU teilgenommen hatte. Der technische Leiter bei USK war überzeugt davon, dass dieses Maschinenkonzept in den Mittelpunkt des Fachinteresses rücken dürfte. „Das Prinzip ist einfach: Entsprechend der Produktionsaufgabe stellen wir mit unserem Kunden die erforderlichen Module zusammen und komplettieren diese mit den aufgabenspezifischen Komponenten“, erläuterte er.
Später ging es noch individueller. Im EU-Forschungsprojekt SkillPro entwickelten 2014 Wissenschaftler des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Maschinen, die individualisierte Massenprodukte wie Möbel, Kleidung oder Kugelschreiber in Losgröße 1 herstellen konnten – alles durch Modularität. Normalerweise muss für jeden neuen Auftrag und jedes neue Produkt auch der Fertigungsprozess umgestellt werden.
Dabei dauert das Umstellen wesentlich länger als die eigentliche Produktion. „Von Maschinen, die mit zusätzlicher Intelligenz ausgestattet sind und miteinander kommunizieren, erwarten wir eine deutliche Reduktion der Umrüstzeit“, sagte Diplom-Ingenieur Thomas Maier, Geschäftsführer des Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI) am KIT damals. Und tatsächlich, das Experiment funktionierte.
Wo das neue Produkt gefertigt wird, ermittelt die Anlage selbst
Bei dem ebenfalls „Plug & Produce“ genannten Verfahren stellen sich die Maschinen im Verbund eigenständig auf das jeweils zu fertigende Produkt ein. Bevor die Produktion startet, errechnet eine Software, in welcher Montagelinie die Aufträge am effizientesten ausgeführt werden. „Zusätzliche Maschinen oder technische Fähigkeiten lassen sich mit geringem Aufwand in einen vorhandenen Maschinenpark einfügen, da sie dem System mitteilen, welchen Part im Produktionsprozess sie übernehmen“, erläuterte Maier. Dabei sind die simulierten Produktionsabfolgen in der Planungsphase und der reale Fertigungsprozess als virtuelle Darstellung auf dem Bildschirm sichtbar.
Roboter teilen die Arbeit untereinander auf
Roboter und Werkzeuge, die sich untereinander verständigen und innerhalb kurzer Zeit wandelbare Fabrikstrukturen bilden können, sind wesentliche Elemente einer solchen „smarten“ Fabrik. In den Werkshallen der „Industrie 4.0“ verschmelzen Fertigungstechnik und Informationstechnologie. Von dieser intelligenten Produktion sollten besonders KMU profitieren. Sie ermöglicht, Nischenprodukte, die in Gestalt oder Passform variieren, kostengünstig zu produzieren. „Die Firmen können eine individualisierte Massenproduktion anbieten und flexibel auf Nachfrageschwankungen reagieren“, so Maier.
Eine weitere Technologie-Initiative, die im Februar dieses Jahres einen Demonstrator zur Hannover Messe 2020 ankündigte (die wegen Covid-19 inzwischen abgesagt wurde), ist die Smart Factory KL e.V. am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Die herstellerunabhängige Forschungsplattform erarbeitet Konzepte, um die „Smart Factory“ in der Industrie zu implementieren. Als Lösung präsentieren die Partner ein erweitertes Safety-Konzept, das modulare Zertifizierungen von der Anlagen- bis zur Komponentenebene ermöglicht und so die Stillstandszeiten beim Umbauen von Anlagen deutlich reduzieren soll.

KI soll und kann den Menschen nicht ersetzen
Die Wissenschaftler setzten das Projekt „Smart Factory Level 4“ auf. Doch während die Ingenieure unter „Smart Factory“ bisher menschenleere Produktionsanlagen verstanden, in denen nur die Maschinen agierten und der Mensch keine Rolle mehr spielte, setzte gerade das DFKI-Projekt einen neuen Akzent: KI soll und kann den Menschen nicht ersetzen. Die Forscher gehen von der Prämisse aus, dass der Mensch eben nicht aus den Produktionsanlagen verschwinden dürfe. „Als Souverän wird und muss der Mensch jede Entscheidung einer Maschine ändern können“, betonte Prof. Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender von Smart Factory-KL. „Es wird unsere Verantwortung bleiben, was in der Produktion passiert. Diese Verantwortung kann und soll uns weder eine Maschine noch künstliche Intelligenz abnehmen.“
Warum entscheiden sich Unternehmen für eine modulare Produktionslinie? „Wir haben mehrere modulare Anlagen im Einsatz“, erklärt Ralf Riemensperger, Leiter Technologiemanagement Produktion im Werk Scharnhausen von Festo. „Jedes der Module deckt einen oder mehrere Arbeitsschritte im Produktionsprozess ab. Das Konzept hat den großen Vorteil, dass wir beim Erstellen der Anlage für jedes Modul denjenigen Lieferanten beauftragen können, der auf das jeweilige Thema spezialisiert ist, beispielsweise die Mess- und Prüftechnik.“ Bei Festo sind diese Linien schon gut fünf Jahre im Einsatz.
Doch wie kann ein Unternehmen auf modulare Produktion umstellen? Bei Festo kamen die Umstände zuhilfe. Bei einem Umzug der Produktion war ein Teil des Maschinenparks ohnehin auszutauschen. So setzte das Unternehmen ein eigenes modulares Konzept auf, das es in Kooperation mit Lieferanten entwickelte. „Die Werkstückträger durchlaufen mit den Produkten in einem Arbeitsgang die Anlagen komplett und ihre Daten werden erfasst und getrackt“, erklärt Riemensperger. „Für die Kommunikation der Steuerungen untereinander nutzen wir verschiedene klassische Protokolle und Schnittstellen, wie sie auch in anderen gängigen Maschinen und Anlagen verwendet werden.“
Durch Modularität bleibt die fertigende Anlage flexibel und veränderbar
Ob modular oder traditionell gefertigt wird, hat auf den Prozess selbst keine Auswirkungen. Trotzdem unterstreicht Riemensperger die Wichtigkeit von Modularität. „Durch die Module haben wir immer die Option, ein Element herauszunehmen, es durch ein anderes zu ersetzen oder die Anlage einfach zu erweitern und neuen Anforderungen anzupassen. Damit bleiben wir jederzeit flexibel. Bei einer klassischen Anlage hätten wir diese Option nicht.“
Modulare Produktionslinien senken Kosten
Obwohl Festo kein KMU mehr ist, „lohnen sich solche modularen Produktionsstraßen auch für KMU“, zeigt sich Riemensperger überzeugt. „Sie bieten zum Beispiel die Chance, ein Produkt und anschließend seine Nachfolgeprodukte auf derselben Anlage zu produzieren, da sie sich flexibel anpassen lässt. So bleiben die Anlagen länger in Benutzung und sind wirtschaftlicher.“

Die Skepsis gegenüber KI bleibt dennoch hier und dort bestehen. Ist die Sorge berechtigt, dass sie uns Menschen ersetzen könnte? Beim Erstellen der Software geht der Programmierer von eigenen Vorstellungen und Überzeugungen aus. Künstliche Intelligenz agiert somit nach Maßgabe des Programmierers und kann nicht neutral sein. Sie befolgt Befehle, die ihr vorschreiben, was sie in welcher Reihenfolge zu tun hat und welche Abläufe Vorrang vor anderen haben sollen – sie ist nicht intelligent, wie der Begriff glauben machen könnte. Maschinelles Lernen ist deshalb die korrektere Bezeichnung.

Viele Mittelständler trauen KI nicht, weil für sie (wie auch für die Smart FactoryKL-Wissenschaftler) ersichtlich sein muss, was sie tut und wie sie es tut. Gleichzeitig muss sie überschaubar bleiben für den Menschen. KI im bisherigen Verständnis hieße jedoch, das sie autonom ohne den Menschen agieren solle. Ein Zustand, den kein Mittelständler akzeptiert – und auch niemand akzeptieren sollte.
Was können KMU tun, um dennoch an dem Prozess der modularen Produktion teilzunehmen? Es gibt vieles. Wichtig ist der Abbau von Ängsten gegenüber neuen Technologien. Dann sollten sie Kooperationen eingehen und ihr Wissen zusammenwerfen. Für die Verpackungsbranche ist Modularität essenziell – sie macht es vor mit ihrem „Packaging Valley“ und ihrem „Packaging Excellence Center“. Mittelständler müssen lernen, „groß“ zu denken: Sie sollten sich wissenschaftlichen Institutionen annähern, die Industriepartner suchen, und die Abneigung gegenüber aufwändigen Antragstellungen überwinden. Es gibt Lösungsansätze, man muss sich nur trauen.